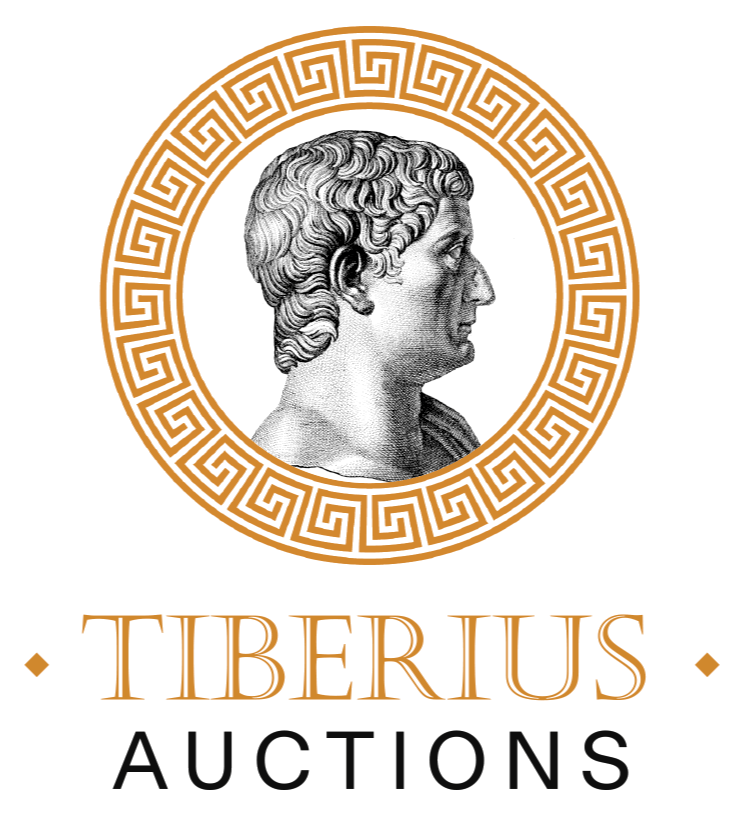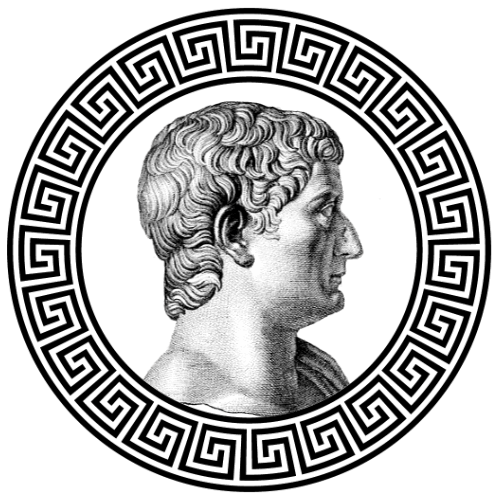Guido Reni
17. Tiberius Auktion
Guido Reni
Startpreis:
€ 3.000
- USD: 3.465 $
- GBP: 2.639 £
Schätzpreis: € 5.000 / 10.000
| von | bis | Gebotserhöhung |
|---|---|---|
| 0 € | 99 € | 5 € |
| 100 € | 199 € | 10 € |
| 200 € | 399 € | 20 € |
| 400 € | 999 € | 50 € |
| 1.000 € | 1.999 € | 100 € |
| 2.000 € | 3.999 € | 200 € |
| 4.000 € | 9.999 € | 500 € |
| 10.000 € | 19.999 € | 1.000 € |
| 20.000 € | 39.999 € | 2.000 € |
| 40.000 € | ∞ | 5.000 € |
Guido Reni
Bologna 1575 – 1642 Bologna, zugeschrieben
Heiliger Sebastian
Öl auf Kupfer
23,5 x 18,5 cm, mit Rahmen 38 x 33 cm
Es handelt sich um eine Darstellung des heiligen Sebastian, die Guido Reni zugeschrieben wird. Guido Reni wurde 1575 in Bologna geboren und zählt zu den bedeutendsten Malern des italienischen Barock. Nach einer Ausbildung bei Denys Calvaert und den Carracci entwickelte er einen Stil, der naturalistische Beobachtung mit klassischer Harmonie verband. Während seines Aufenthalts in Rom ab 1601 stand er in künstlerischem Dialog mit Caravaggio, dessen dramatische Lichtführung er zu einer idealisierten, fast überirdischen Lichtmalerei transformierte. Nach seiner Rückkehr nach Bologna im Jahr 1614 leitete Reni eine erfolgreiche Werkstatt und prägte mit seinen religiösen Gemälden das Bild einer vergeistigten, ästhetisch verklärten Frömmigkeit. Seine Figuren, in Licht getaucht und von Anmut durchdrungen, verkörpern eine Balance aus Schönheit, Leid und Erlösung.
Der heilige Sebastian war ein römischer Offizier, der unter Kaiser Diokletian wegen seines christlichen Glaubens verfolgt wurde. Nachdem er an einen Baum gebunden und von Bogenschützen durchbohrt worden war, überlebte er zunächst, trat erneut für seinen Glauben ein und wurde schließlich zu Tode geprügelt. In der Kunst gilt Sebastian seither als Symbol des Leidens und der spirituellen Reinheit – ein Märtyrer, dessen Körper zwischen Schmerz und Anmut schwebt.
Im Vordergrund des Gemäldes ist der Heilige nackt, nur mit einem violetten Lendentuch bekleidet, dargestellt. Mit dem rechten, über den Kopf erhobenen Arm ist er an einen alten Baumstamm gebunden. Sein Körper bildet eine dynamische S-Linie: Der Kopf ist zurückgefallen, der Blick nach oben gerichtet, zwischen Entrückung und Ohnmacht. Die linke Hand ist hinter dem Körper verschränkt, die Beine sind nach links abgewinkelt und leicht verkrampft dargestellt. Mehrere Pfeile durchbohren den Körper, aus den Wunden tritt Blut in feinen Rinnsalen aus. Der Heilige liegt halb gegen einen Felsvorsprung, der seine Körperhaltung aufnimmt. Baum und Fels rahmen den Heiligen, der im Zentrum der Komposition steht. Die Lichtführung ist von zentraler Bedeutung: Die Lichtquelle trifft direkt auf den Körper, dessen Inkarnat beinahe weiß erscheint. So wird der muskulöse Körper in seinem Martyrium dramaturgisch inszeniert, um im Betrachter Mitgefühl und Anteilnahme zu wecken.
Auf der linken Seite öffnet sich eine friedvolle Landschaft mit einem See, Bäumen und einer hügeligen Bergkette. Der Himmel changiert von hellem Blau bis zu aufziehendem Grau – eine Stimmung, die das dramatische Geschehen im Vordergrund reflektiert. Der Moment, den Reni darstellt, zeigt den Heiligen kurz nach dem Beschuss durch die Pfeile, nachdem er bereits zu Boden gesunken ist: allein, seinem Schicksal überlassen und doch noch immer mit einem Arm an den Baum gebunden. Diese Verbindung verhindert den völligen Sturz und betont den Moment zwischen Leben und Tod. Der Mund ist leicht geöffnet, die Augenlider schwer, das lange Haar fällt über die Schultern. Durch den Kontrast zwischen dem hellen Körper und dem dunklen Baumstamm wird der die Figur des Heiligen noch stärker hervorgehoben.
Das Motiv folgt der typischen Ikonographie des heiligen Sebastian, doch Reni verleiht ihm eine besondere Emotionalität. Im Vergleich etwa zu Jusepe de Riberas Darstellung des Sebastian von 1651, der mit offener Körperhaltung gen Himmel blickt, erscheint Renis Figur introspektiv und vergeistigt. Sie ist nicht wachsam, sondern in sich gekehrt, der Schmerz nach innen verlagert. Während Ribera den dramatischen Moment der Fürsprache mit Gott zeigt, deutet Reni auf den Zustand der Erschöpfung, das langsame Nachgeben des Körpers, die physische und seelische Hingabe. Die gedrehte Körperhaltung steigert die Dynamik und den Ausdruck des Leidens, die Wundmale werden Teil einer fast idealisierten Körperinszenierung. Besonders eindrucksvoll ist die feine Fältelung des violetten Perizoniums, das Renis Streben nach formaler Eleganz unterstreicht.
In dieser Komposition verschmilzt Pathos mit körperlicher Schönheit. Reni macht das Martyrium nicht nur zum Abbild des Schmerzes, sondern auch zur Darstellung der Erleuchtung: Der heilige Sebastian wird zum Symbol göttlicher Reinheit, sein Körper zum Träger des Lichts. Diese Vergeistigung und das Streben nach einem ätherischen Schönheitsideal machen Guido Renis Werk zu einem Inbegriff barocker Andacht und zur Verbildlichung des katholischen Glaubensgefühls im 17. Jahrhundert.