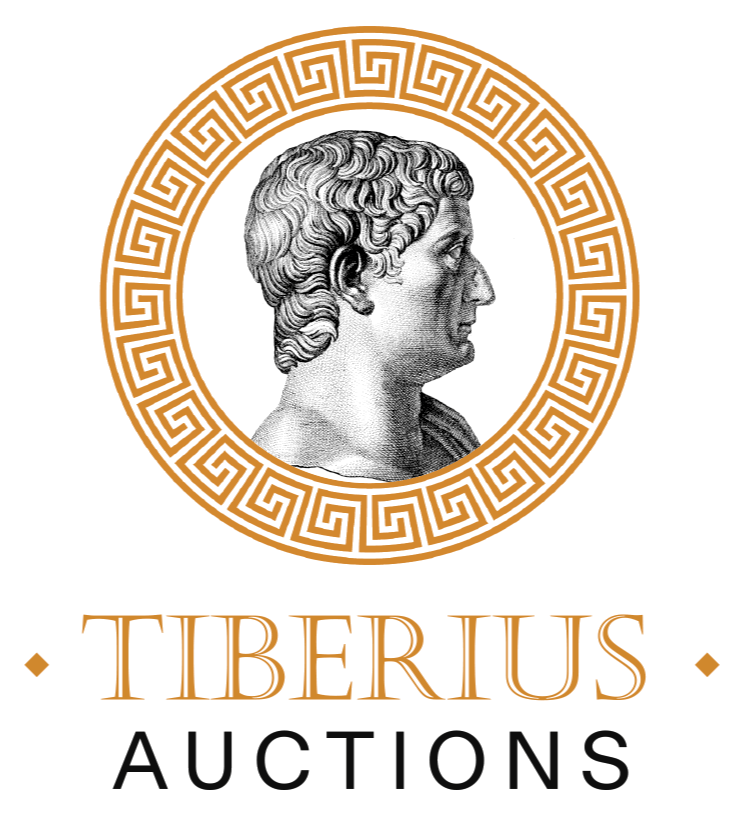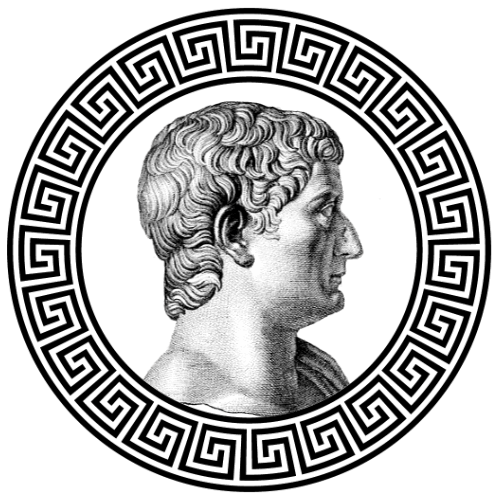Heiliger Johannes der Täufer
TIBERIUS – NACHVERKAUF
Heiliger Johannes der Täufer
Nachverkaufspreis:
€ 15.240
- USD: 17.968 $
- GBP: 13.306 £
Heiliger Johannes der Täufer
Böhmen
Um 1410/15
Holz geschnitzt, mit Leinen kaschiert
Höhe 107 cm
Rückseitig gehöhlt
Skulptur zwischen Askese und Hofkunst
Diese monumentale Holzskulptur des heiligen Johannes des Täufers entstand vermutlich kurz nach 1400 in Böhmen. Die plastische Ausarbeitung, das lebendige Inkarnat und die virtuose Behandlung von Haar und Falten legen einen Einfluss der Werkstatt des Meister Theoderich nahe – jener berühmten Künstlerpersönlichkeit, die unter Karl IV. als Hofmaler wirkte und deren Werkstatt als stilprägend für die Prager Kunst um 1380-1400 gilt.
Darstellung und Ikonographie
Johannes erscheint hier als erhabener Bußprediger, ausgestattet mit seinen typischen Attributen: Das Gewand aus Kamelhaar – Sinnbild der asketischen Lebensweise – ist mit erstaunlicher Feinheit geschnitzt. Das Haar ist annähernd symmetrisch gelockt und dadurch herzförmig angeordnet. Darüber liegt ein goldener, mit rotem Futter ausgeschlagener Mantel, der mit einer Brosche zusammengehalten ist und in seiner Pracht einen spannungsvollen Kontrast zur einfachen Lebensweise des Heiligen bildet. Barfuß steht der Heilige auf der Bodenplatte – eine betonte Erdung, die auf seine Wüstenexistenz verweist. Die sehnigen Füße mit gelängten Zehen weisen nochmals auf seine Askese hin. In der linken Hand trägt er ein Buch, vermutlich die Heilige Schrift, als Zeichen seiner Rolle als Prediger. Die rechte Hand ist im klassischen Verkündigungsgestus erhoben: Mittel- und Zeigefinger sowie der Daumen zeigen nach oben, ein sprechender Ausdruck seiner prophetischen Mission. Die langgliedrigen Finger zeigen naturalistisch ausgeformte Fingernägel sowie Kerbungen an der Handfläche, wodurch die Figur einen nahbaren Eindruck vermittelt.
Feinste Schnitzarbeit
Besonders bemerkenswert ist das plastisch fein gearbeitete Haupt- und Barthaar: Das dichte, symmetrisch herabfallend mit einer auffälligen, einzelnen Stirnlocke – ein charakteristisches Merkmal, das sich ebenfalls bei der Darstellung des heiligen Veit in der Kreuzkapelle von Karlstein findet. Diese Parallelen zur Theoderich-Werkstatt – sowohl im Haarstil als auch in der naturalistischen Gesichtsgestaltung – sprechen für eine stilistische Nähe zu diesem Werkstattkreis. Die Gesichtszüge von Johannes sind äußerst lebendig modelliert: Gerötete Wangen und wache Augen mit prominenten, hochgezogenen Brauen verleihen der Figur eine dialogische Präsenz. Sein Blick scheint sich an einen tieferstehenden Betrachter zu richten – wohl ein Hinweis auf die einstige Aufstellung in erhöhter Position, vermutlich innerhalb eines Altars oder größeren Raumgefüges einer Kirche.
Faltenstil und Bewegungsfluss
Der Faltenwurf des goldenen Mantels verbindet körpernahe Modellierung mit dem typischen, voluminösen Stil der böhmischen Kunst um 1400: Am Oberkörper enganliegend, fällt der Stoff in einer eleganten Schüsselfalte ab, die sich nach unten hin in großzügige, dynamische Bordüren öffnet. Eine markante dreieckige Schüsselfalte mit mehrfachen Knickfalten sorgt für lebendige Bewegtheit. Die sogenannte „teigige“ Weichheit der Draperie verweist auf die Übergangszeit zum sogenannten Weichen Stil, wie er im böhmischen Kontext besonders reich entwickelt wurde.
Ein Werk des Prager Hofkreises?
Die stilistische Nähe zu Werken der Theoderich-Werkstatt legen nahe, dass die Johannesfigur von einem Meisterschnitzer in diesem Umfeld gefertigt worden sein könnte. Die Werkstatt, die unter der Schirmherrschaft Kaiser Karls IV. an der Ausstattung der Prager Kathedrale und der Burg Karlstein mitwirkte, war ein Ort intensiver künstlerischer Zusammenarbeit zwischen Malern, Bildhauern und Fassmalern. Werke aus diesem Umkreis waren nicht nur Ausdruck religiöser Frömmigkeit, sondern dienten auch dem Repräsentationsbedürfnis des aufstrebenden Prager Hofes, der sich als „neues Rom“ inszenierte.
Warum Johannes der Täufer?
Johannes der Täufer spielte in der religiösen Kultur Böhmens um 1400 eine zentrale Rolle. Als Bußprediger und Wegbereiter Christi war er eine Schlüsselfigur für die Reformbewegungen, die sich in Prag bereits vor den hussitischen Unruhen artikulierten. Seine mahnende Botschaft von Umkehr und Läuterung sprach insbesondere ein städtisch-akademisches Publikum an, so auch die Prager Universität als Zentrum theologischer Debatte. Die Darstellung des Heiligen als lehrender Prophet, der im Gespräch mit dem Betrachter steht, passt hervorragend in diesen intellektuellen Kontext.
Fazit
Diese Skulptur des heiligen Johannes des Täufers ist weit mehr als ein Andachtsbild: Sie verbindet geistliche Tiefe mit höchster künstlerischer Ausarbeitung. Der stilistische Zusammenhang mit der Theoderich-Werkstatt verleiht ihr zusätzliche Bedeutung als Zeugnis böhmischer Kunst. Die eindringliche Präsenz des Heiligen, die virtuose Behandlung von Gewand, Haar und Gesicht sowie die lehrhafte Ausstrahlung machen sie zu einem Meisterwerk böhmischer Skulptur am Anfang des 15. Jahrhunderts – geschaffen an einem Ort, an dem Kunst, Frömmigkeit und Macht aufs Engste miteinander verwoben waren.
Literatur
Jiří Fajt & Jan Royt, Magister Theodoricus. The court painter of Emperor Charles IV. The artistic decoration of the sacral rooms at Karlštejn Castle, Prague 1997.
Gustav E. Pazaurek, “Theoderich”, in: Allgemeine Deutsche Biographie 37, Leipzig 1894, pp. 708-710.